
„The Science of Persuasion.“ Methoden des Überzeugens
By value2habit.de | Published | Keine Kommentare
Wenn wir uns auf das Ansinnen Anderer einlassen, dann ist es zwar unsere Entscheidung. Aber neben unserer eigenen Abwägung wirken im Hintergrund ganz bestimmte Hebel kräftig mit. Das passiert nicht zufällig, denn es gibt sechs tief verankerte Auslöser, auf die wir Menschen gerne reagieren und die oft gezielt eingesetzt werden.
Diese sechs allgemeingültigen Grundprinzipien des Überzeugens wurden vom US-amerikanischen Psychologen Robert B. Cialdini empirisch erforscht und Mitte der 1980er Jahre veröffentlicht. Sie gelten heute als Leitkriterien erfolgreicher Überzeugungsarbeit.
Hilfreich ist die Kenntnis dieser sechs Prinzipien nicht nur, wenn man sich in der aktiven Position desjenigen befindet, der Andere überzeugen will. Auch in unserer passiven Rolle, in einer an Informationen und medialen Impulsen überladenen Welt, kann es nützlich sein, sich dessen bewußt zu werden, mit welchen Hebeln jemand gerade versucht, uns von etwas zu überzeugen.
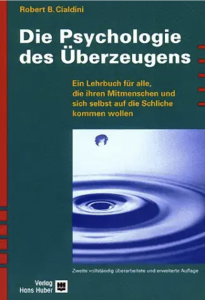
Auch bei stark rational geprägten oder von Evidenzkriterien geleiteten Entscheidern, wie Ärzten, Wissenschaftlern oder Finanzleuten, sind es bekanntlich eben nicht die rein faktenbasierten Argumente oder Aspekte, die letzten Endes Einfluss auf Entscheidungen haben.
1. Gegenseitigkeit (»Reciprocity«)
Eine der am stärksten verbreiteten Normen der menschlichen Kultur. Diese Regel besagt, dass Menschen versuchen sollen, sich für das, was sie von anderen bekommen, zu revanchieren.
Das durch diese Regel vermittelte Gefühl, etwas schuldig zu bleiben, wenn man etwas bekommen hat, ist die Grundlage für verschiedene Formen des menschlichen Miteinanders, die auf einem ausgeglichenen Verhältnis von Geben und Nehmen beruhen und die allesamt sehr nützlich für die Gesamtgemeinschaft sind.
Eine häufig eingesetzte Taktik besteht darin, etwas zu geben, ehe sie um eine Gegenleistung bitten. Die Wirksamkeit dieser Taktik beruht auf drei Merkmalen der Reziprozitätsregel:
- Die Regel an sich ist extrem effektiv und schaltet oft den Einfluss anderer Faktoren aus.
- Sie wirkt auch bei ungebetenen ersten Gefälligkeiten.
- Führt nicht selten zum Austausch ungleicher Gefälligkeiten.
Eine Variation der Regel wirkt in gleicher Weise: Durch Zugeständnisse kann man andere dazu bringen, ihrerseits ebenfalls Zugeständnisse zu machen (Neu-Verhandeln-nach-Rückweisung-Taktik). Mit einer Extremforderung zu beginnen, die mit Sicherheit abgelehnt wird, schafft günstige Voraussetzungen dafür, eine geringere Forderung nachschieben zu können, die dann mit hoher Wahrscheinlichkeit akzeptiert wird, weil sie als Zugeständnis erscheint.
2. Knappheit (»Scarcity«)
- Dinge, die schwerer zu bekommen sind, sind meist auch wertvoller, wodurch die Verfügbarkeit einer Sache als Hilfe zur Einschätzung ihrer Qualität dienen kann.
- Die zunehmende Unerreichbarkeit einer Sache bedeutet einen Verlust an Freiheit. Nach der Reaktanztheorie reagieren wir auf den Verlust auf Freiheit damit, dass wir sie mehr haben wollen als zuvor.
- Dinge werden als wertvoller eingeschätzt, die erst neuerdings knapp geworden sind, als solche, die schon immer knapp waren.
- Knappe Ressourcen sind für uns verlockender, wenn wir mit anderen um sie in Konkurrenz treten müssen.
3. Autorität (»Authority«)
- Titel
- Kleidung
- Auto
4. Konsistenz (»Consistency«)
- diesem Verhalten von der Gesellschaft ein hoher Wert beigemessen wird,
- es sich in der Praxis meistens gut bewährt hat,
- es den Umgang mit der Komplexität des modernen Lebens erleichtert.
5. Sympathie (»Liking«)
- Körperliche Attraktivität:
Die äußere Schönheit bringt Vorteile in sozialen Interaktionen und „färbt ab“ auf den Eindruck, den das Gegenüber von anderen Persönlichkeitseigenschaften wie Begabung, Freundlichkeit und Intelligenz hat. - Lob und Anerkennung:
Komplimente fördern die Sympathie und damit auch die Bereitschaft, zu tun, was jemand von einem verlangt. - Vertrautheit durch wiederholte (positive) Kontakte:
Ein besonders effektiver positiver Kontakt ist die erfolgreiche gemeinsame Kooperation - Assoziation:
Man stellt eine Verbindung zwischen sich selbst oder den eigenen Produkten und einer positiven Sache her
6. Soziale Bewährtheit (»Social Proof«)
- Unsicherheit:
Wenn eine Person unsicher oder die Situation mehrdeutig ist, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie die Aufmerksamkeit auf die Handlungen anderer richtet und deren Verhalten als das richtige ansieht. - Ähnlichkeit:
Man neigt eher dazu, es jemandem gleichzutun, der einem ähnlich ist.
*) Literatur: R.B. Cialdini, Die Psychologie des Überzeugens, Huber Verlag, Bern, 4. Auflage 2006
Mehr erfahren.
Lernen Sie Ansatzpunkte kennen, um das optimale Set von Überzeugungstriggern für Ihre Produkte und Dienstleistungen über Value Coaching optimal zu erstellen. Nutzen Sie unsere kostenlose Erstberatung (remote, bis zu 1h):






